Kriegsflüchtende in der Ukraine finden in den gewerkschaftlichen Sanatorien und Hotels der relativ sicheren Westukraine Schutz und ein vorübergehendes Zuhause. Der ÖGB bringt dafür Hilfsgüter. Aus erster Hand erfahren wir von den Binnengeflüchteten wie unseren Gewerkschafts-Kolleg:innen, was der russische Krieg in der Ukraine mit ihnen macht.
Von Lia Musitz
Für die tägliche Arbeit der Föderation der Gewerkschaften der Ukraine, kurz FPU, ist ein Kleinbus dringend nötig. Individuelle Spenden und finanzielle Unterstützung des IGB, EGB und ÖGB machten es möglich, nicht nur einen Bus anzuschaffen, sondern ihn auch mit benötigter Bettwäsche für die Versorgung von Geflüchteten vollzuladen. So bepackt machten wir, das sind Marcus Strohmeier, Robert Walasinski und Lia Musitz vom Internationalen Sekretariat des ÖGB und der Abteilung für EU und Internationales der Arbeiterkammer, uns am 2. Mai auf den Weg, um den Wagen und die Hilfsgüter der FPU zu bringen.
Gewerkschaften seit Jahren unter großem Druck

Unsere erste Station in der Ukraine ist Ushhorod im Oblast Transkarpatien, unfern der Grenze zur Slowakei. Im Zentrum der Stadt neben dem Amthaus der Lokalregierung befand sich einst symbolisch das massive Zentralgebäude der örtlichen Gewerkschaften. Heute ist ihr Gewerkschaftsgebäude ein ehemaliges Kultur- und Theaterzentrum etwas abseits des Stadtkerns. Vor diesem erzählt der lokale Gewerkschaftspräsident Ivan Zelinsky, dass ihre Übersiedlung nicht ganz freiwillig war. Vor etwa vier Jahren waren maskierte Männer in ihre alte Zentrale eingedrungen. Sie hatten einen Räumungsbefehl in Händen. Nun steht das Gebäude leer und verfällt. Diese Leerstelle ist Symbol für einen bereits vor dem Krieg einsetzenden politisches Prozess der Zurückdrängung von Gewerkschaftsorganisationen in der Ukraine. Unter Sowjetzeiten von unzähligen Mitgliedern und ihren Beiträgen gestützt, bauten die ukrainischen Gewerkschaften viele Sanatorien, Krankenhäuser und Hotels für die medizinische Rehabilitation und Erholung der Arbeitnehmer:innen. Heute sind viele dieser Immobilien auf dem Markt viel wert und von der Enteignung durch die Regierung bedroht.
Der russische Krieg in der Ukraine treibt die politische Marginalisierung der Gewerkschaftsbewegung weiter voran. Das ausgerufene Kriegsrecht verlängerte die Arbeitszeit auf 60 Stunden und verkürzte den Anspruch auf Erholung von Arbeitnehmer:innen auf einen Tag in der Woche. Kollektivverträge sind ausgesetzt. Demonstrationen und Streiks sind verboten. Die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften im Dialog mit Arbeitgeber:innen und der Regierung ist damit geschwächt. Zu Gesprächen, so wird uns erzählt, zeigt die Regierung ohnehin wenig Bereitschaft. Letztere führte zwar eine tripartite Kommission ein, da sie aber entweder keine Termine für deren stattfinden frei hat oder an ihnen nicht teilnimmt, erteilt sie der Sozialpartnerschaft informell eine Absage. Der Oblast Transkarpatien hat mittlerweile die niedrigsten Löhne der Ukraine. Die Mietpreise jedoch, zählen zu den höchsten. Schließlich bietet die Verortung zu mehreren Landesgrenzen und NATO-Staaten eine gewisse Sicherheit vor Angriffen der russischen Armee, die auch der Wohnungsmarkt einpreist. Nicht von der Hand zu weisen, erklärt die Lokalregierung, dass der sichere Westen der Ukraine die Wirtschaft des kriegsgeplagten Landes aufrechterhält. Deswegen müssen die lokalen Arbeitnehmer:innen die Wirtschaftsleistung für den Rest des kriegsgebeutelten Landes erbringen. Gleichzeitig wird bereits jetzt daran gearbeitet, beste Bedingungen für ausländische Unternehmen zu schaffen, um Investitionen anzulocken.
Gewerkschaften leisten tatkräftig Hilfe für Kriegsvertriebene
Dabei leistet die Gewerkschaft einen wichtigen Beitrag für die Versorgung der Opfer des Krieges. Im ganzen Land stellen sie ihre Gebäude als Unterkunft für Binnen-Geflüchtete zur Verfügung, betreuen sie und organisieren nationale wie internationale Hilfeleistungen. Ihr internationales solidarisches Netzwerk ist von großem Vorteil. In den gewerkschaftlichen Sanatorien von Poljana und Morschyn konnten wir uns bei der Überbringung von Bettwäsche ein persönliches Bild machen. Das Sanatorium von Poljana ist ein großes Areal in einem Erholungsgebiet in den Bergen Transkarpatiens. Einst lebten hier beinahe 160 Geflüchtete, heute sind es 58. Sie leben in gut ausgestatten Zimmern mit Bad und begrenztem Warmwasser, W-Lan, Kühlschrank und Fernseher. Ein verblichener Schick vergangener Sowjetzeiten liegt im Raum. Ein Mal am Tag werden die Geflüchteten mit warmen Essen aus der Betriebsküche versorgt. Die restliche Verpflegung müssen sie von ihrem eigenen Einkommen bestreiten. Der ukrainische Staat zahlt jedem Geflüchteten etwa 50 Euro im Monat. Die geringen Unterstützungszahlungen sind nicht das Einzige, was die großteils älteren Frauen belastet. Sie erzählen uns davon, dass ihre Söhne sie vor dem Krieg hier in Sicherheiten brachten, um als Soldaten gleich wieder in den Krieg zu ziehen. Ein älteres Ehepaar ist aus Bachmut geflüchtet. Sie berichten uns, dass zuerst ihr Haus zerstört wurde und sie nun hier ihren Sohn begraben mussten, der im Krieg gefallen war. Eine andere Frau antwortet, dass sie nicht weiß, wo sie nach dem Kriegsende hinsoll. Ihre Heimat ist und bleibt zerstört. Ein Zuhause wird es für sie nicht mehr geben. Die Finanzierung der Versorgung und Betreuung der Geflüchteten in Poljana, die bisher eine amerikanische NGO übernahm, läuft in einem Monat aus. Die 58 Kriegsvertriebenen wissen nicht wohin.
Das Sanatorium in Morschyn im Oblast Lemberg wiederum beherbergt noch heute etwa 140 Geflüchtete. Zu Hochzeiten der Krise waren es über 300. Auch hier haben die Geflüchteten Zimmer mit Bad und W-Lan, aber die Räume sind klein, höchstens 10m2 groß. Sie leben dort zu zweit. Zwei Waschmaschinen teilen sich alle und eine improvisierte Küche gemeinsam pro Stock. Die Bettwäsche, die wir mitgebracht haben, findet sofort Abnehmer:innen. Die Betreuer:innen der Flüchtlinge sind herzlich und besonders engagiert. Auch in Morschyn werden die Menschen einmal am Tag mit warmen Essen versorgt.

Eine Dame aus Luhansk erzählt uns unter Tränen, dass ihre Flucht seit 2014 andauert. Auch ihr Sohn ist Soldat an der Front. Sie weiß nicht, ob sie ihn wiedersehen wird, noch wie sie sich ihr Leben finanzieren soll oder ihre Zukunft aussieht.


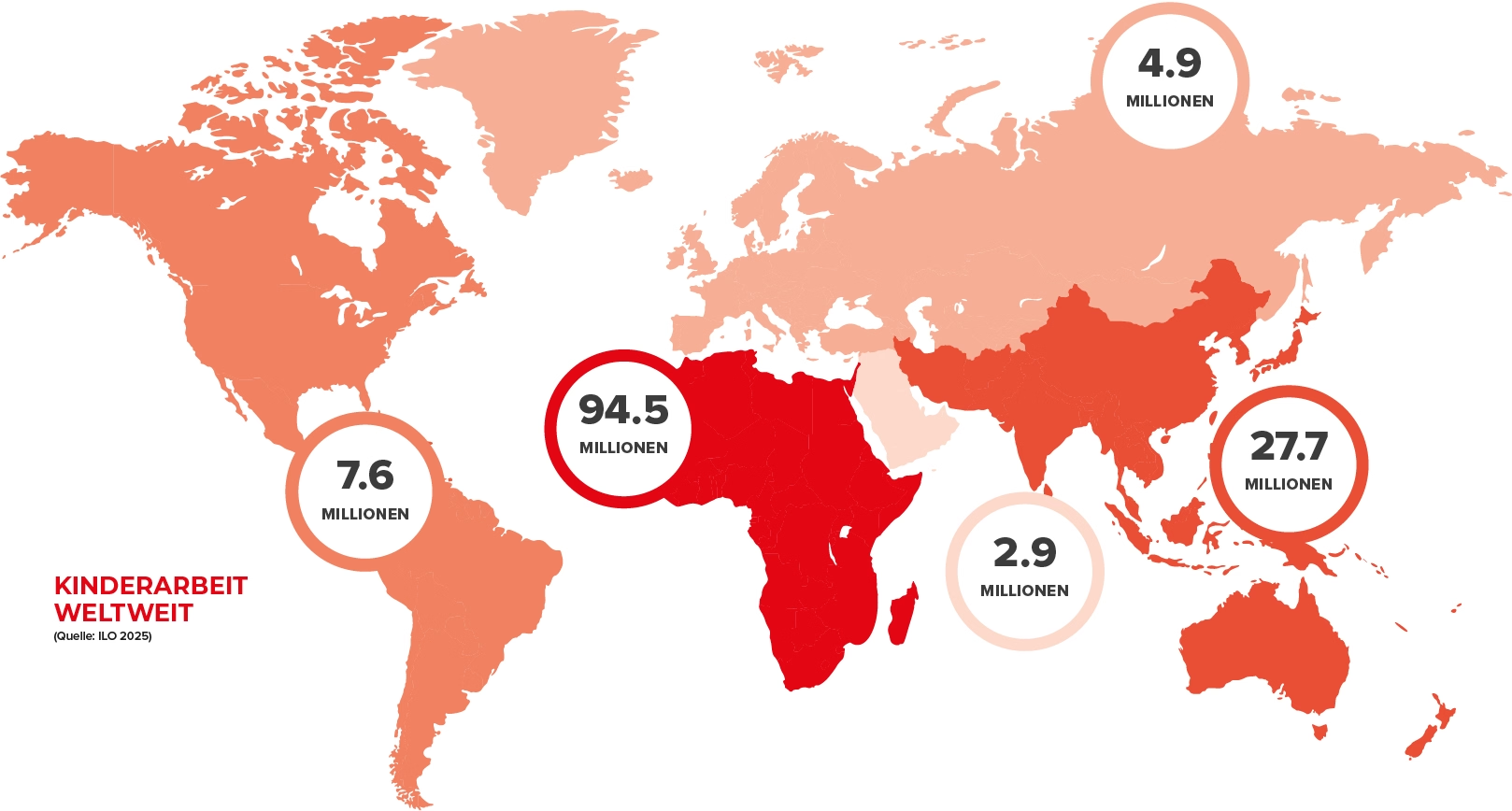

.avif)
